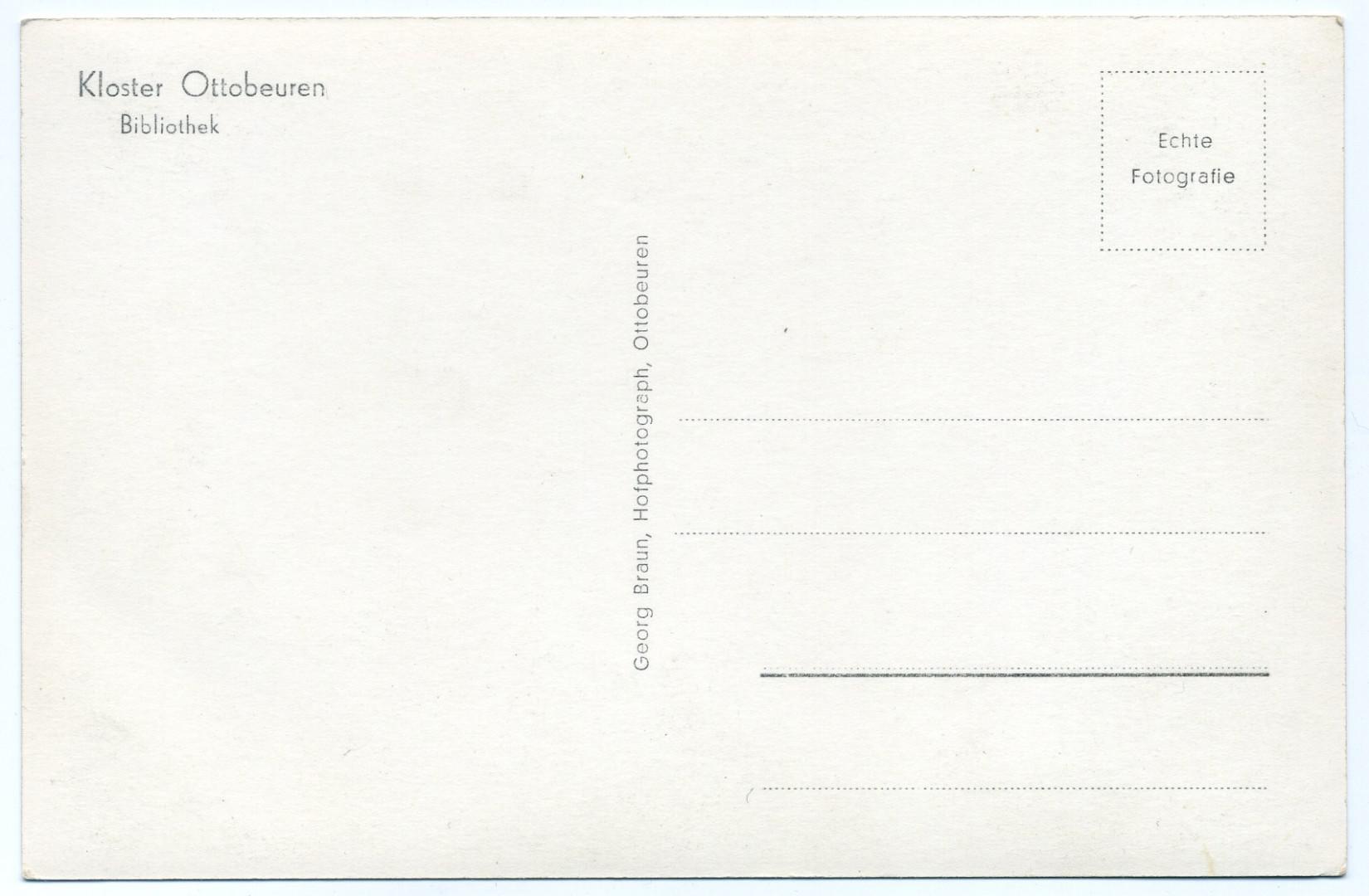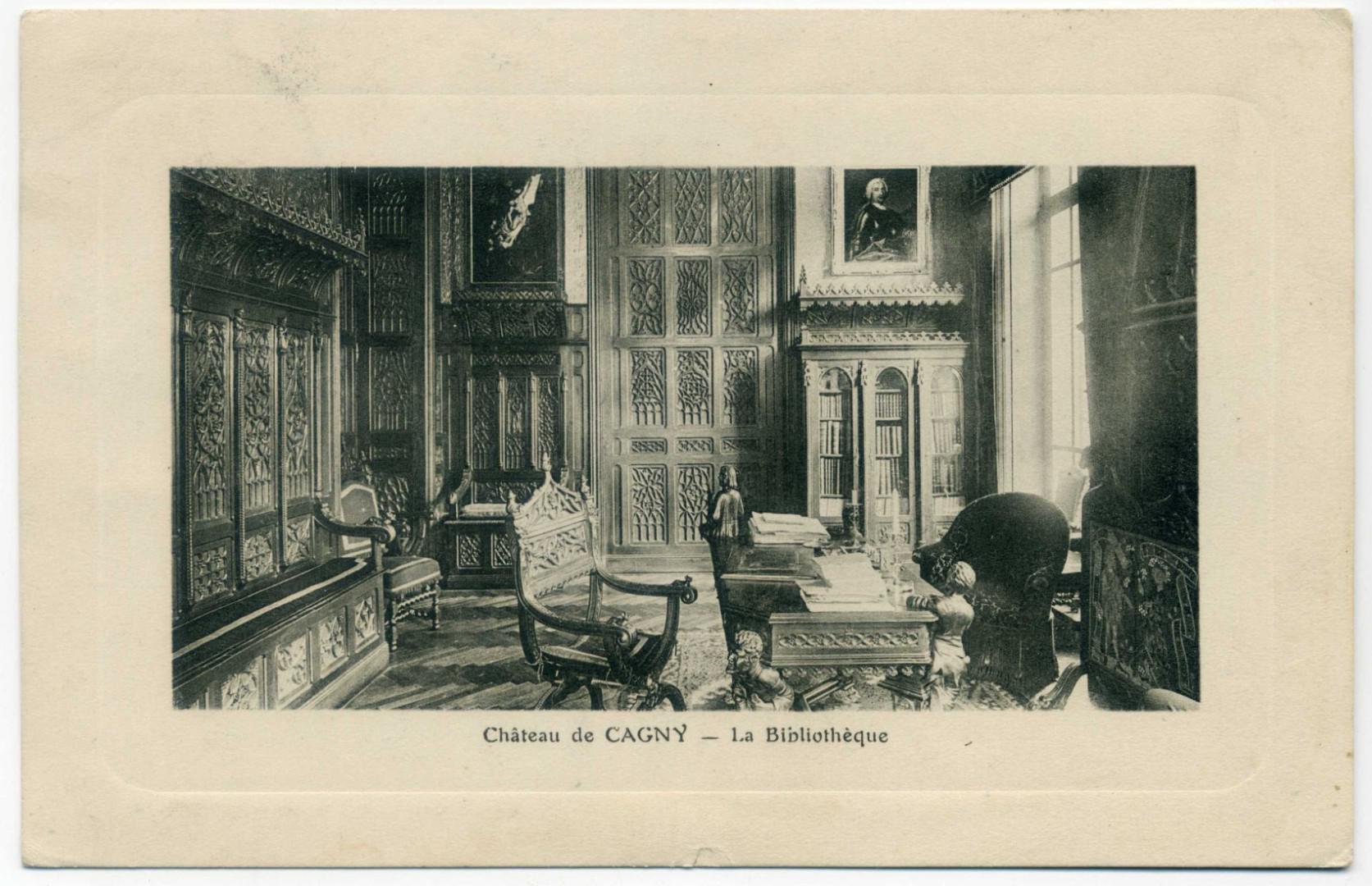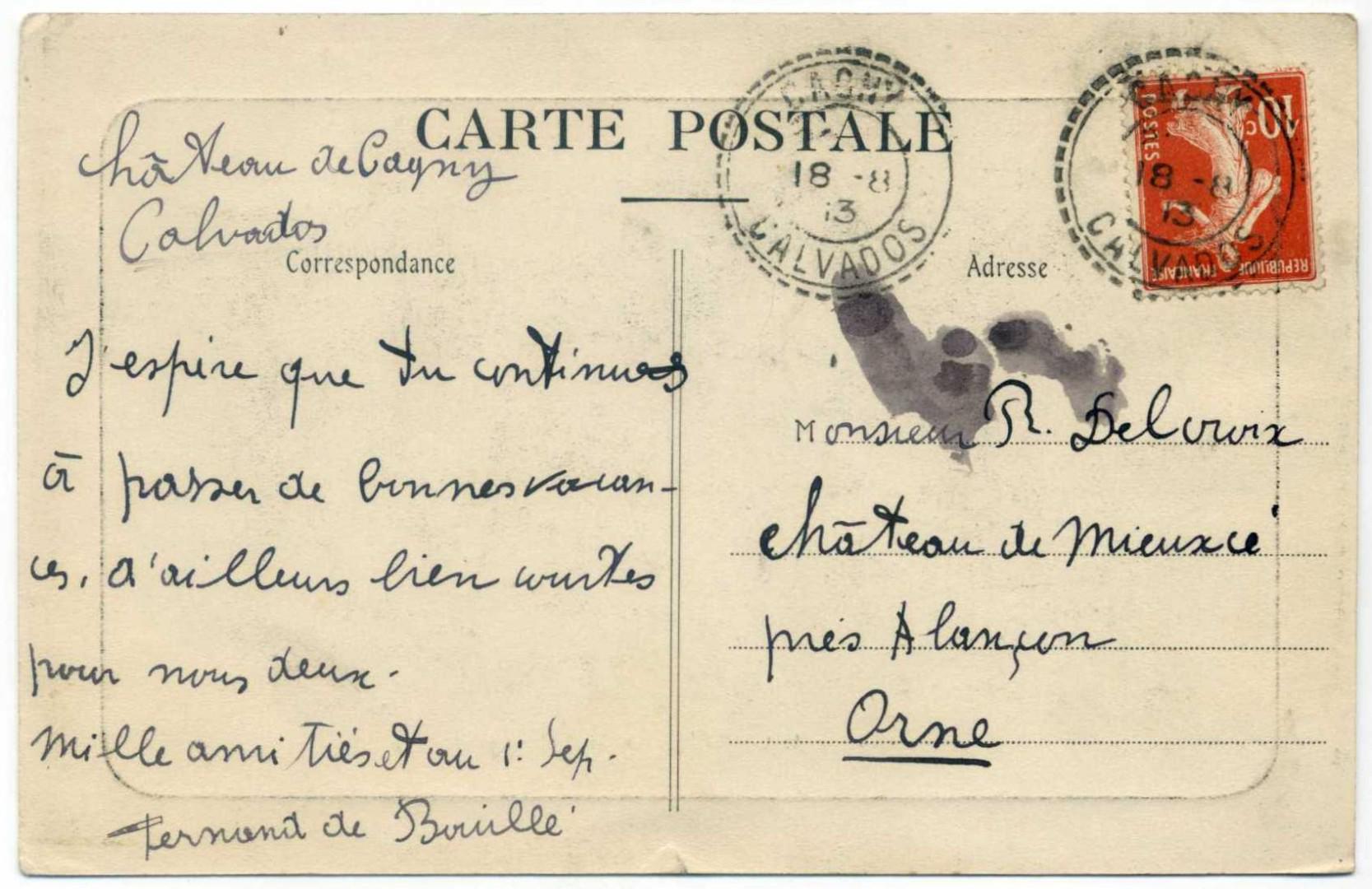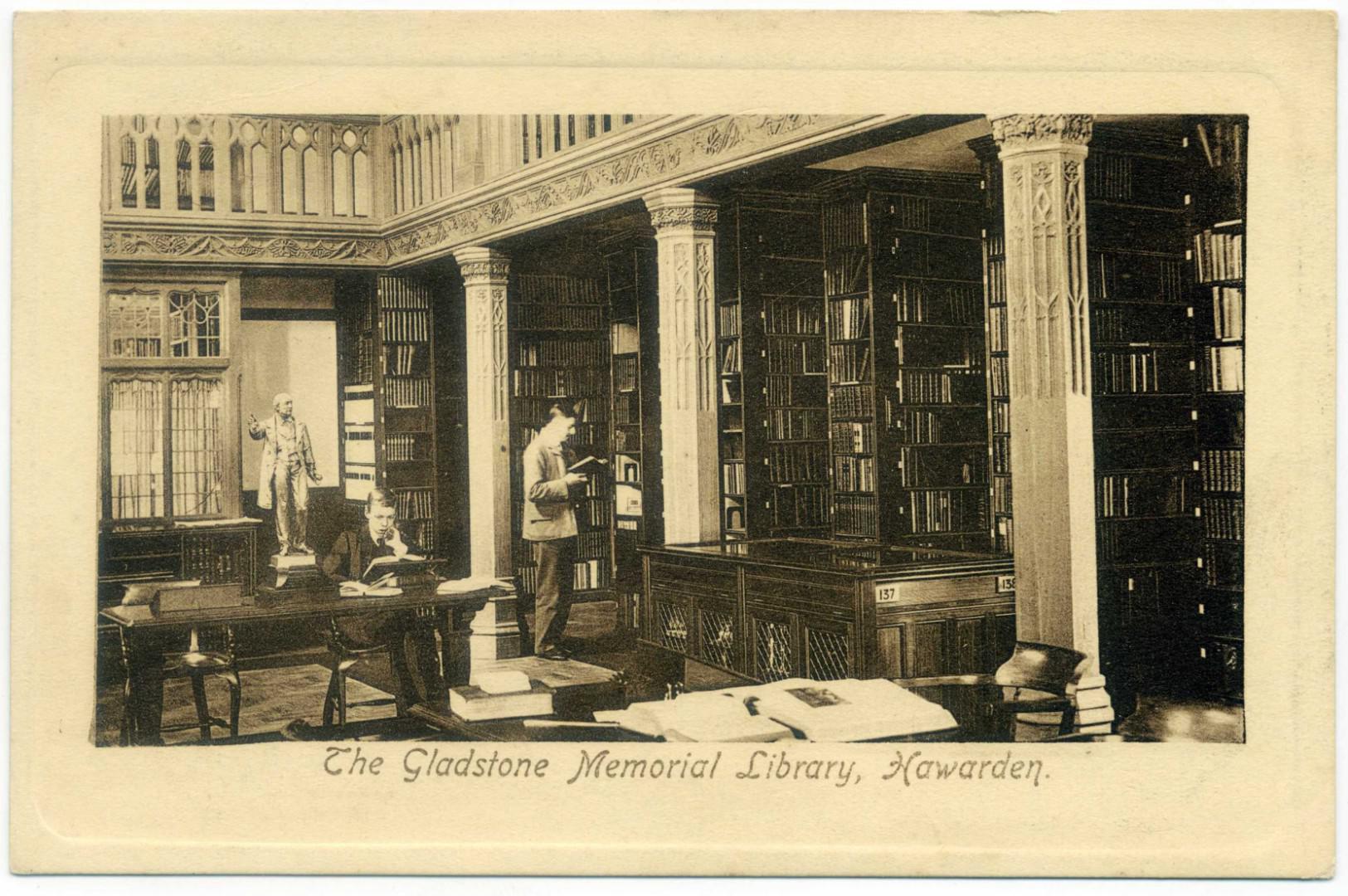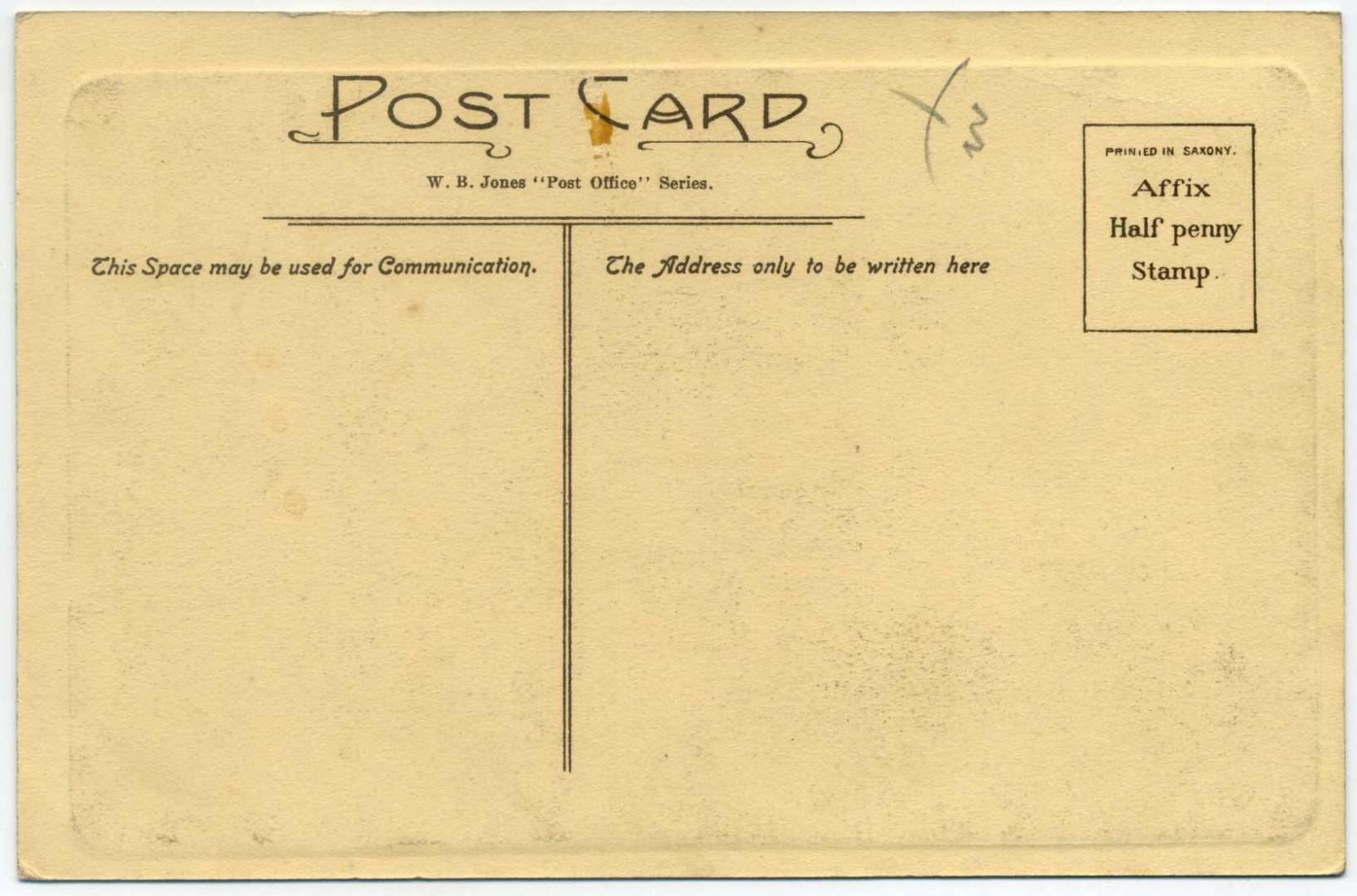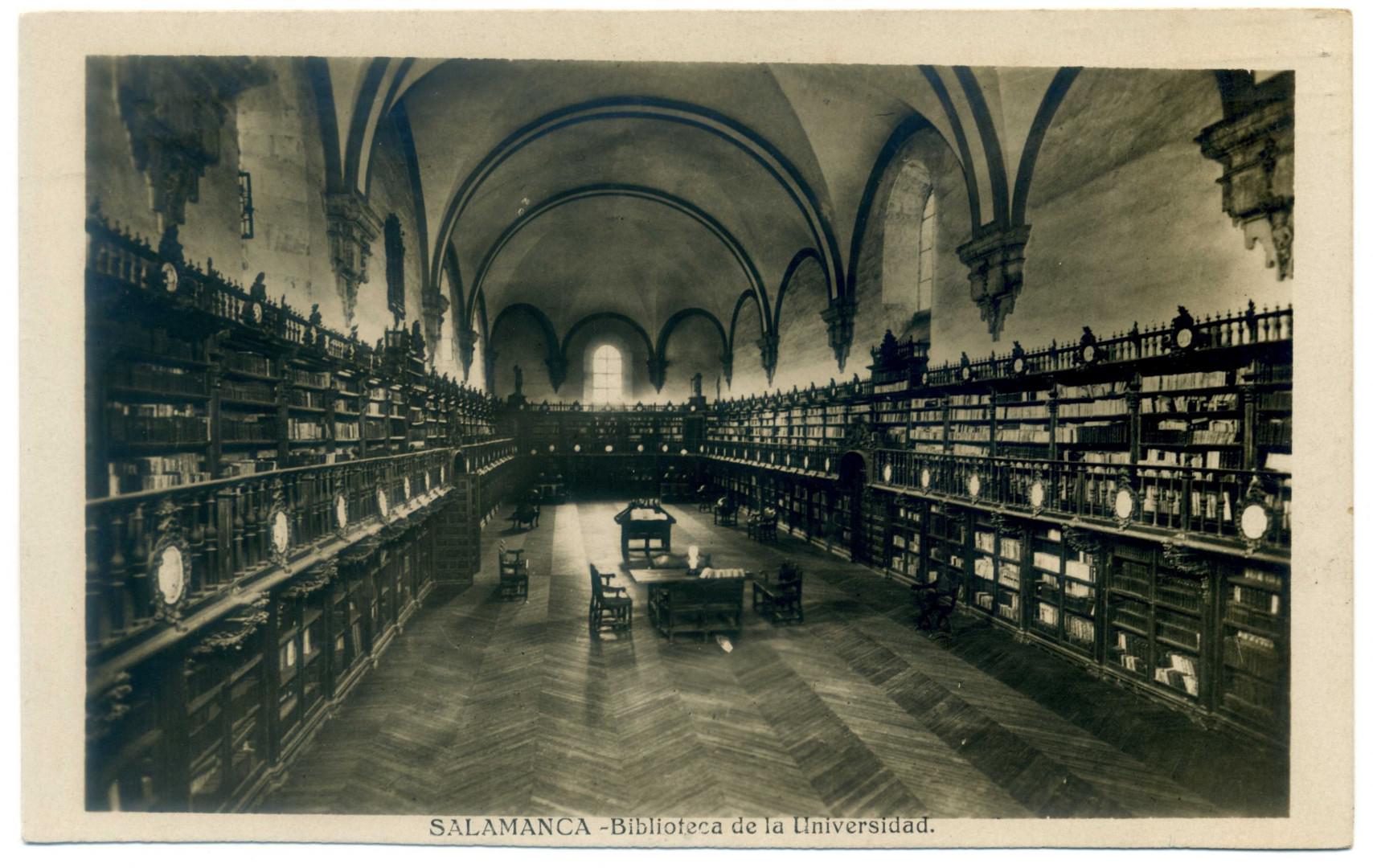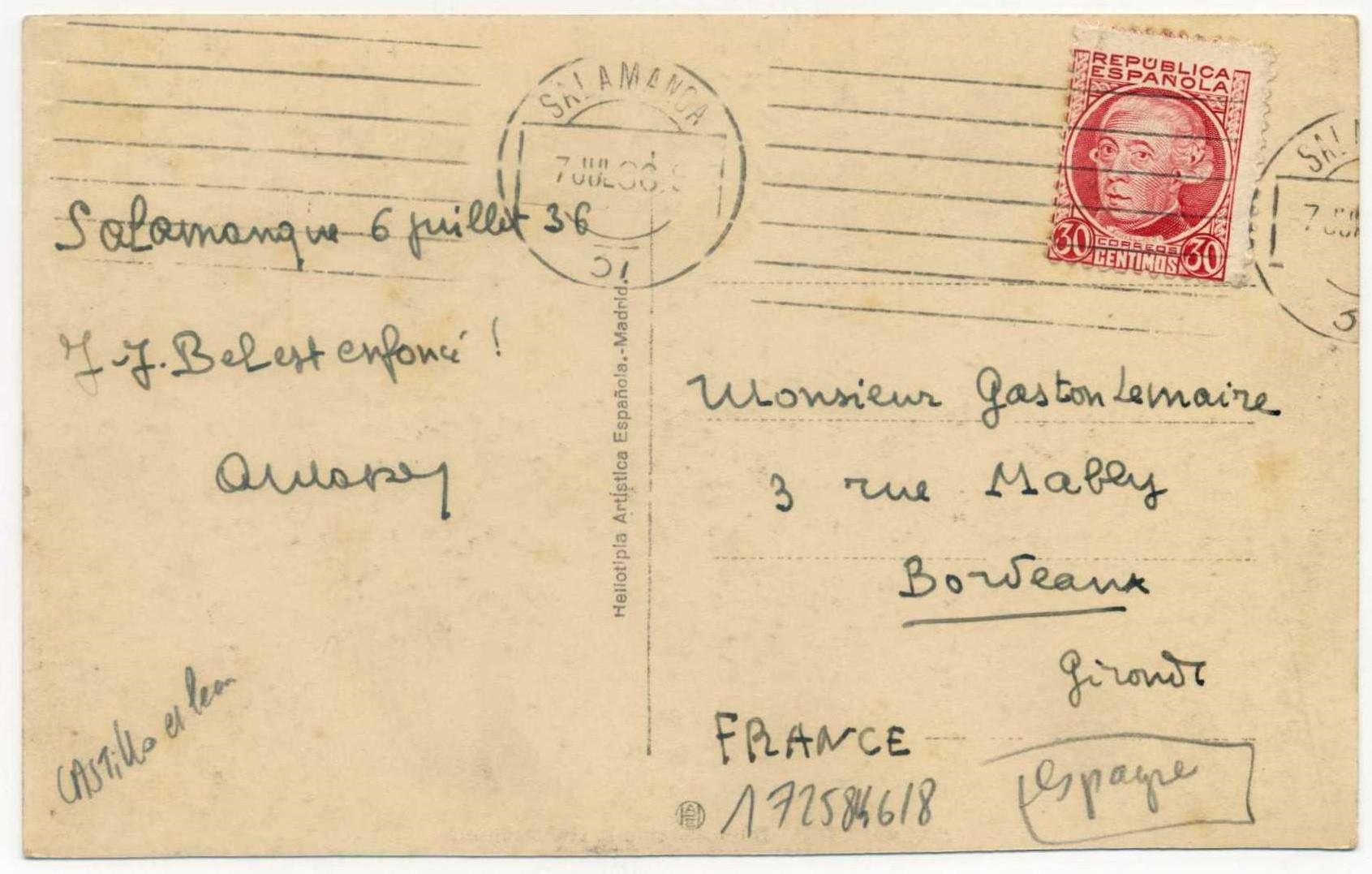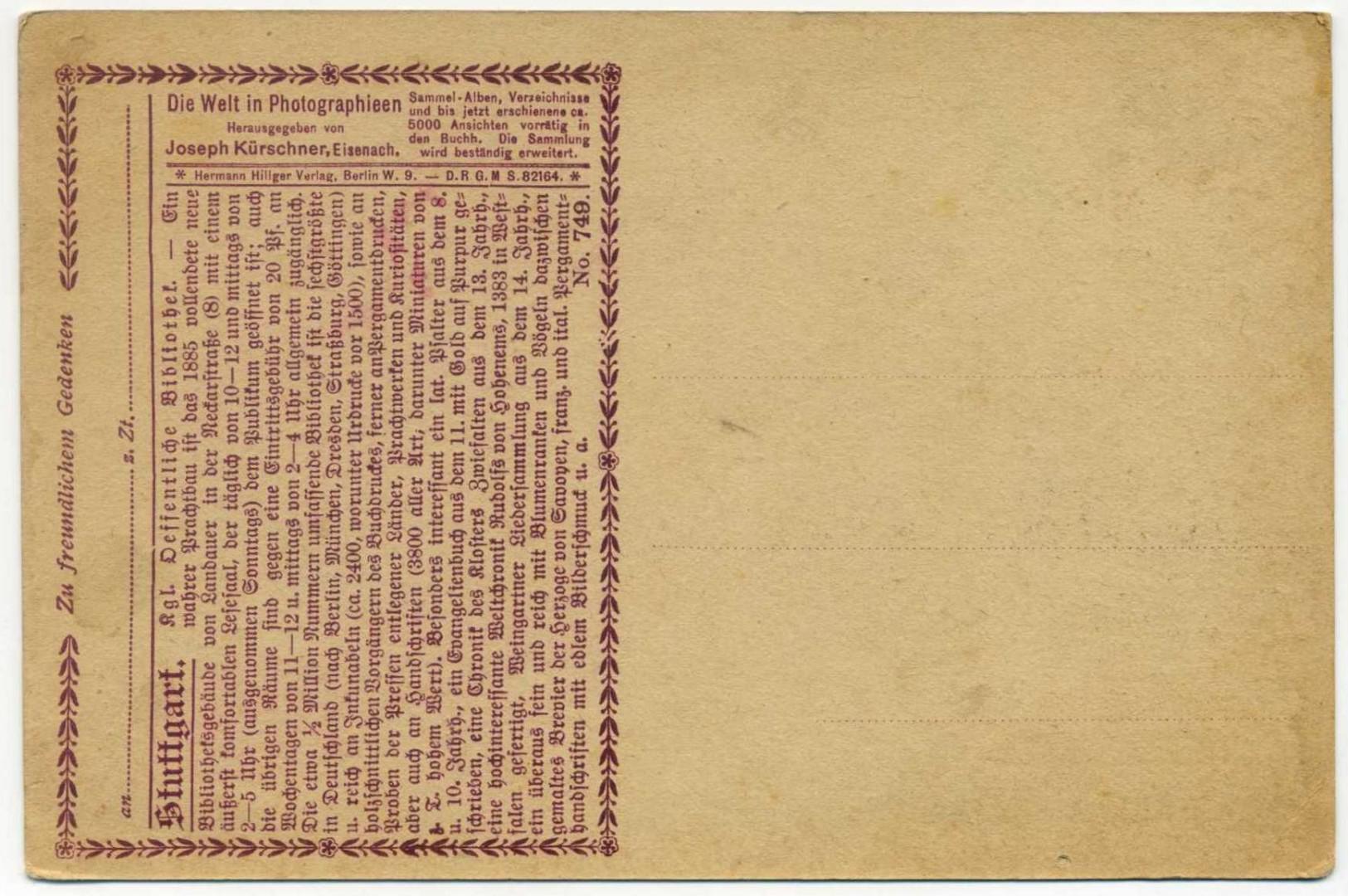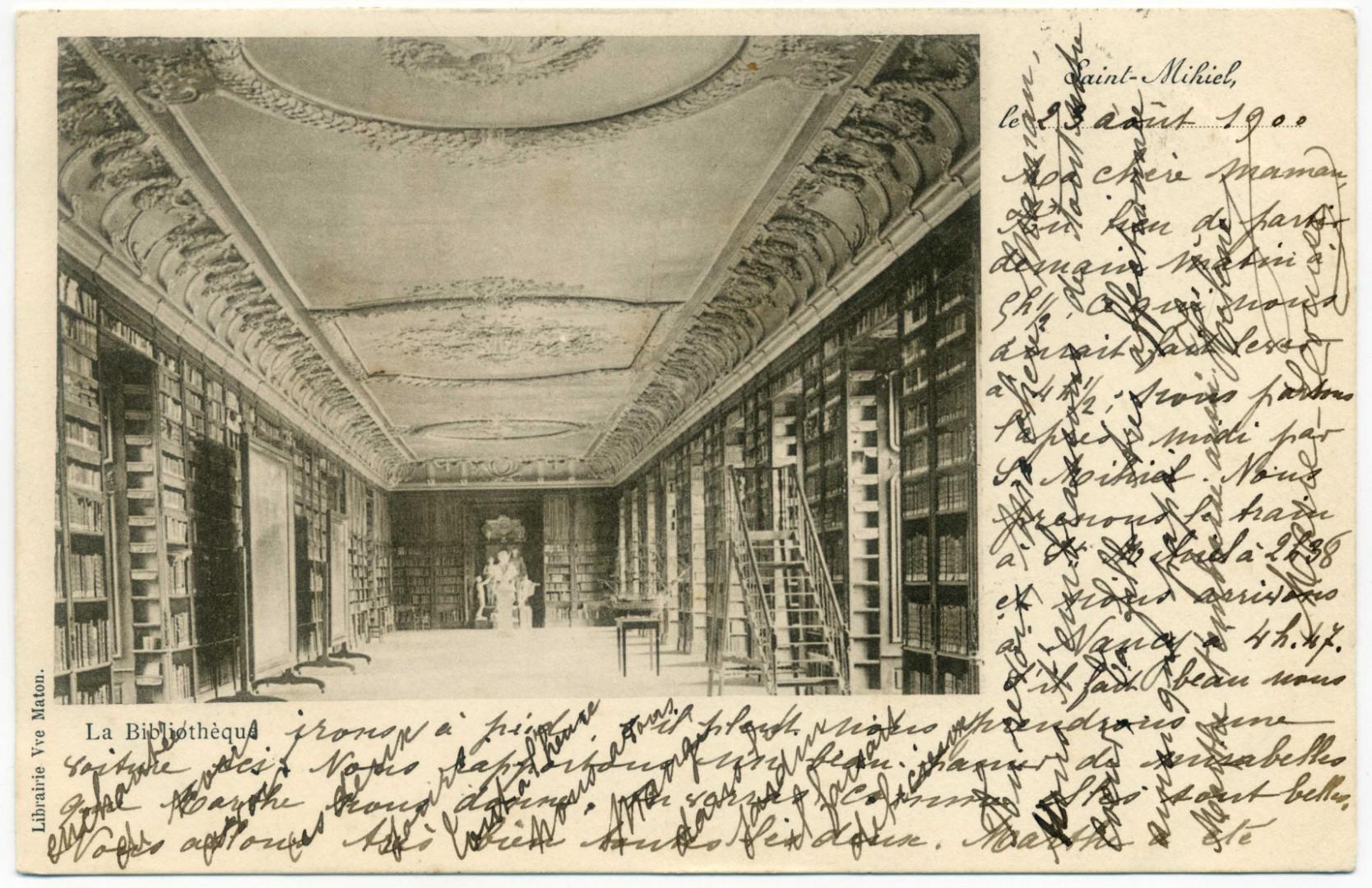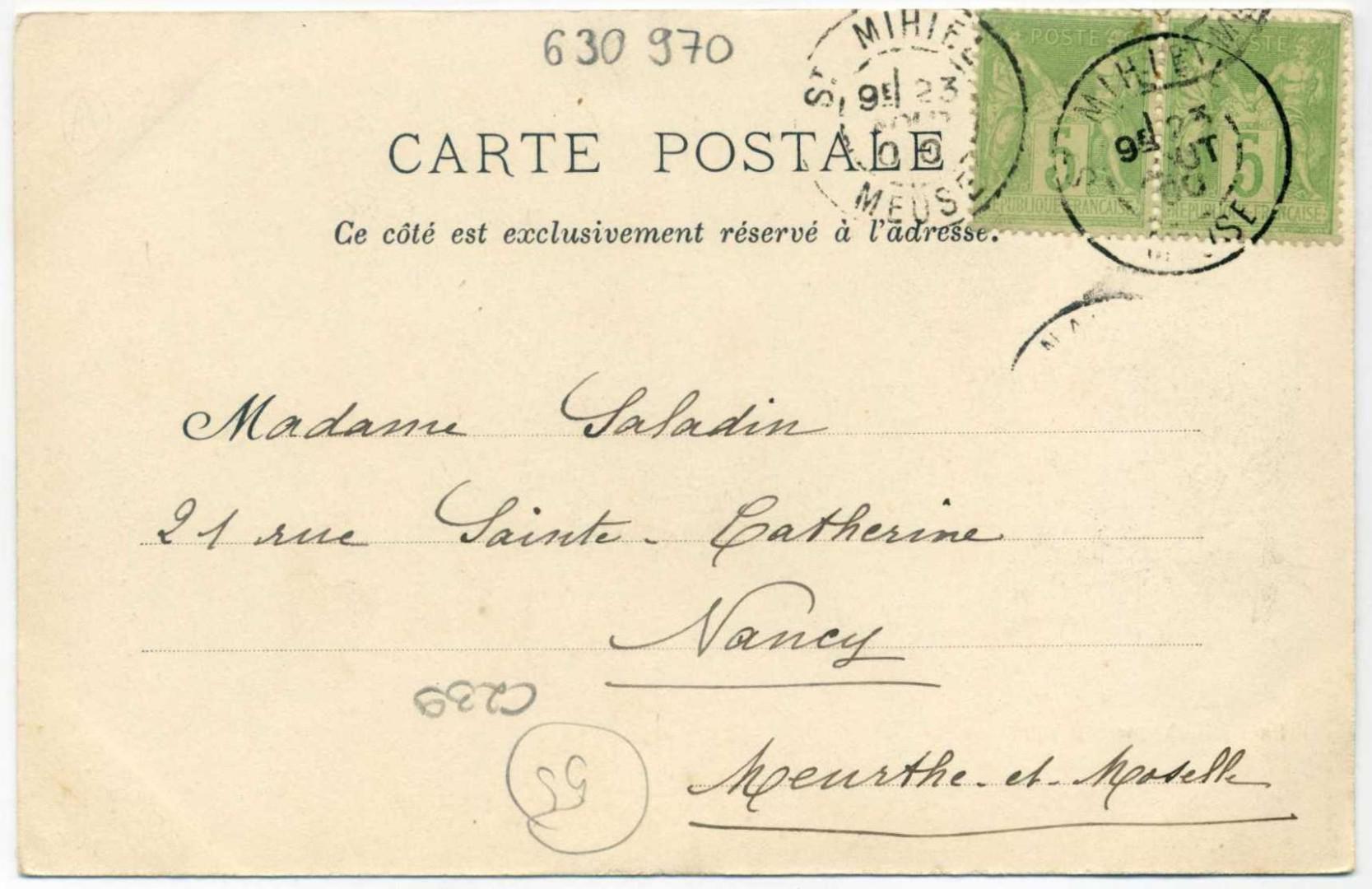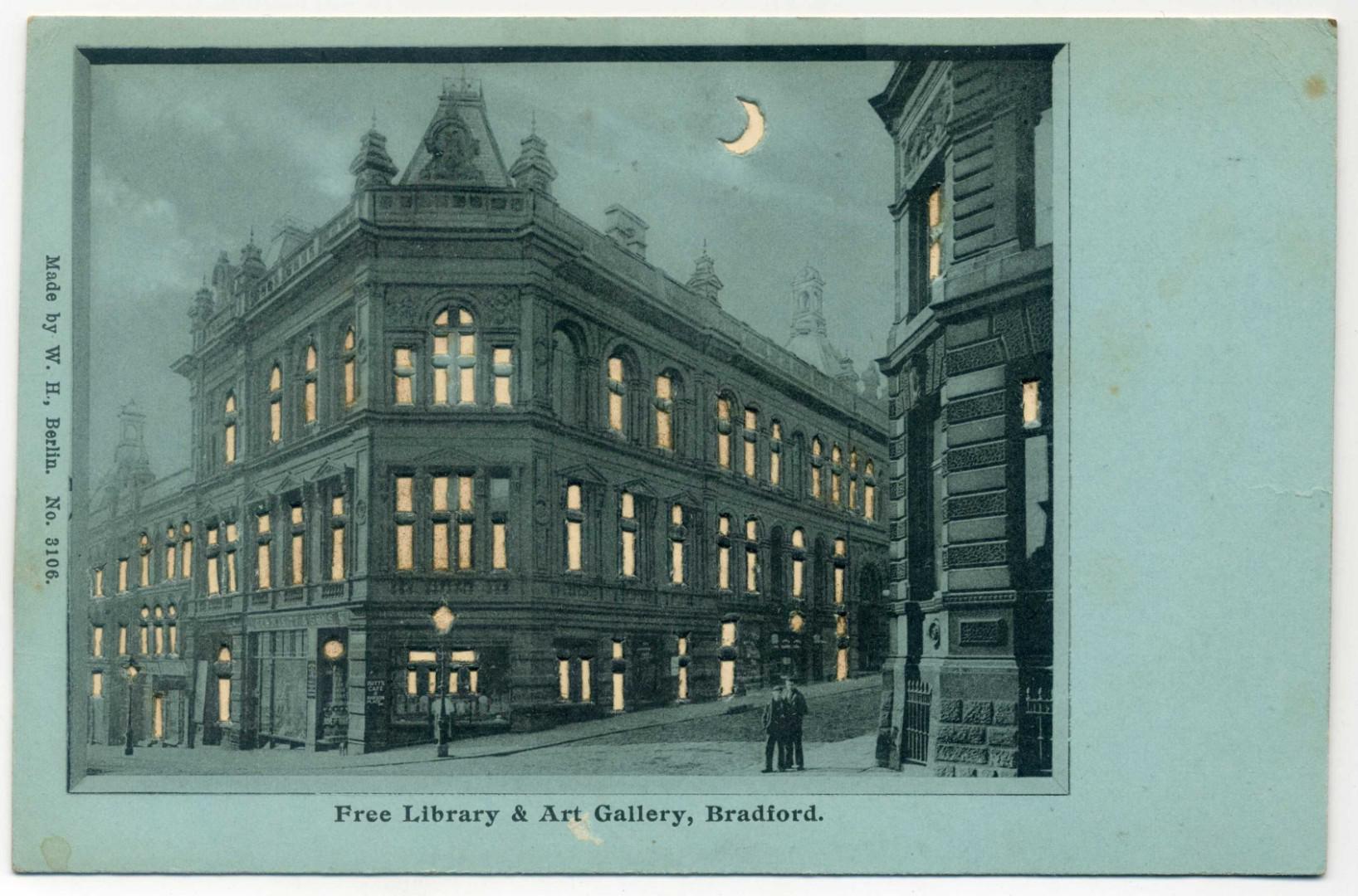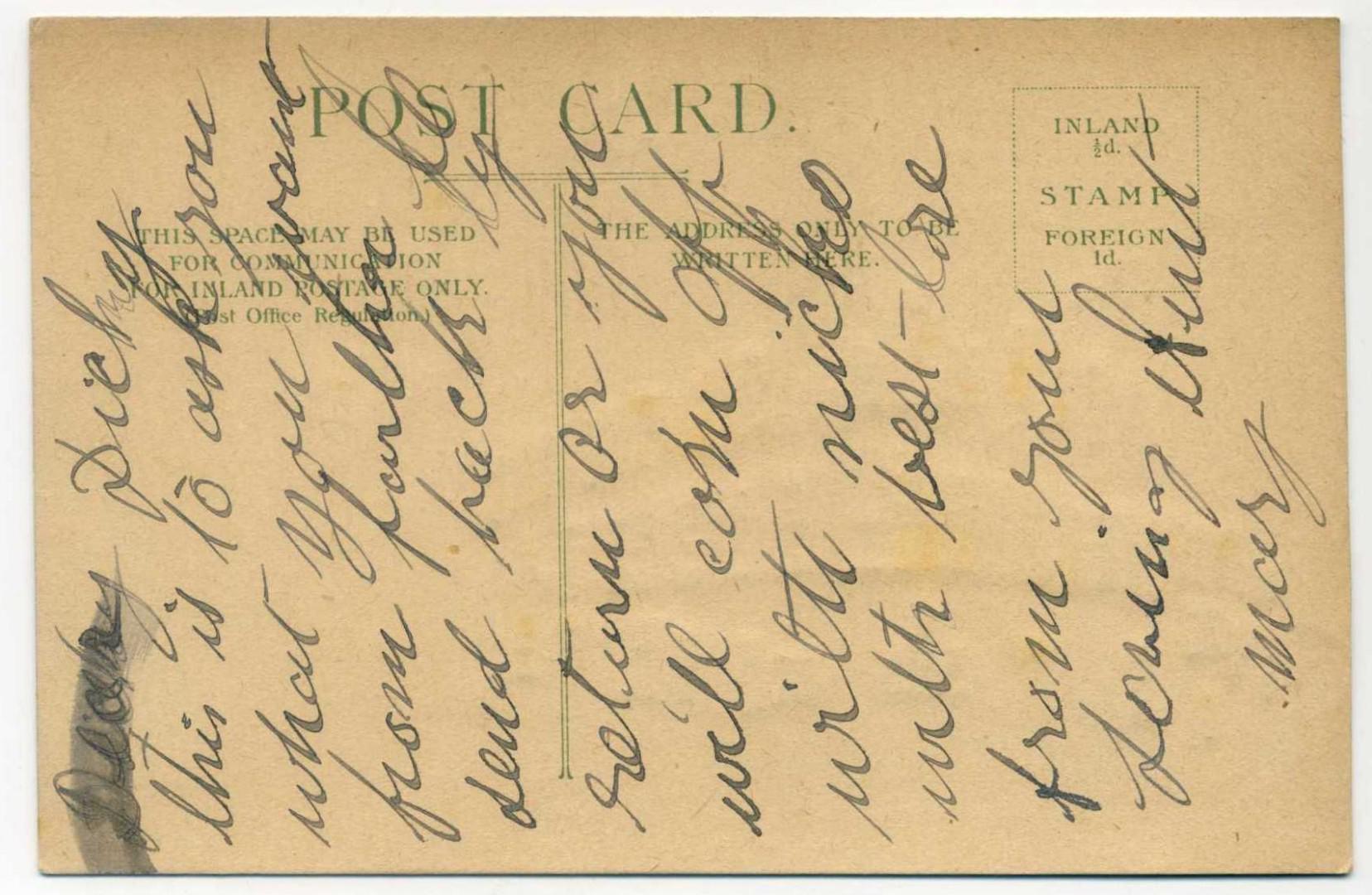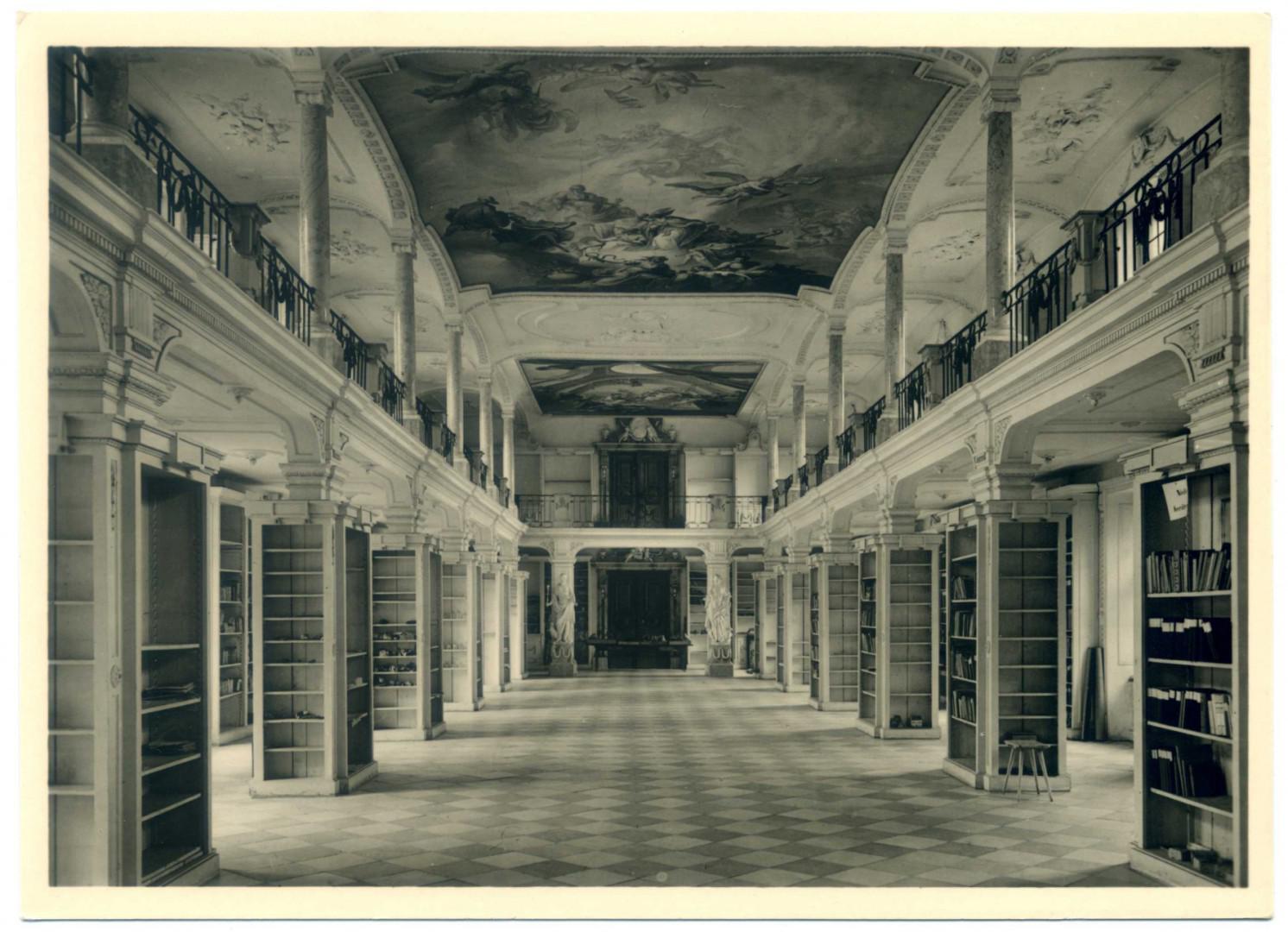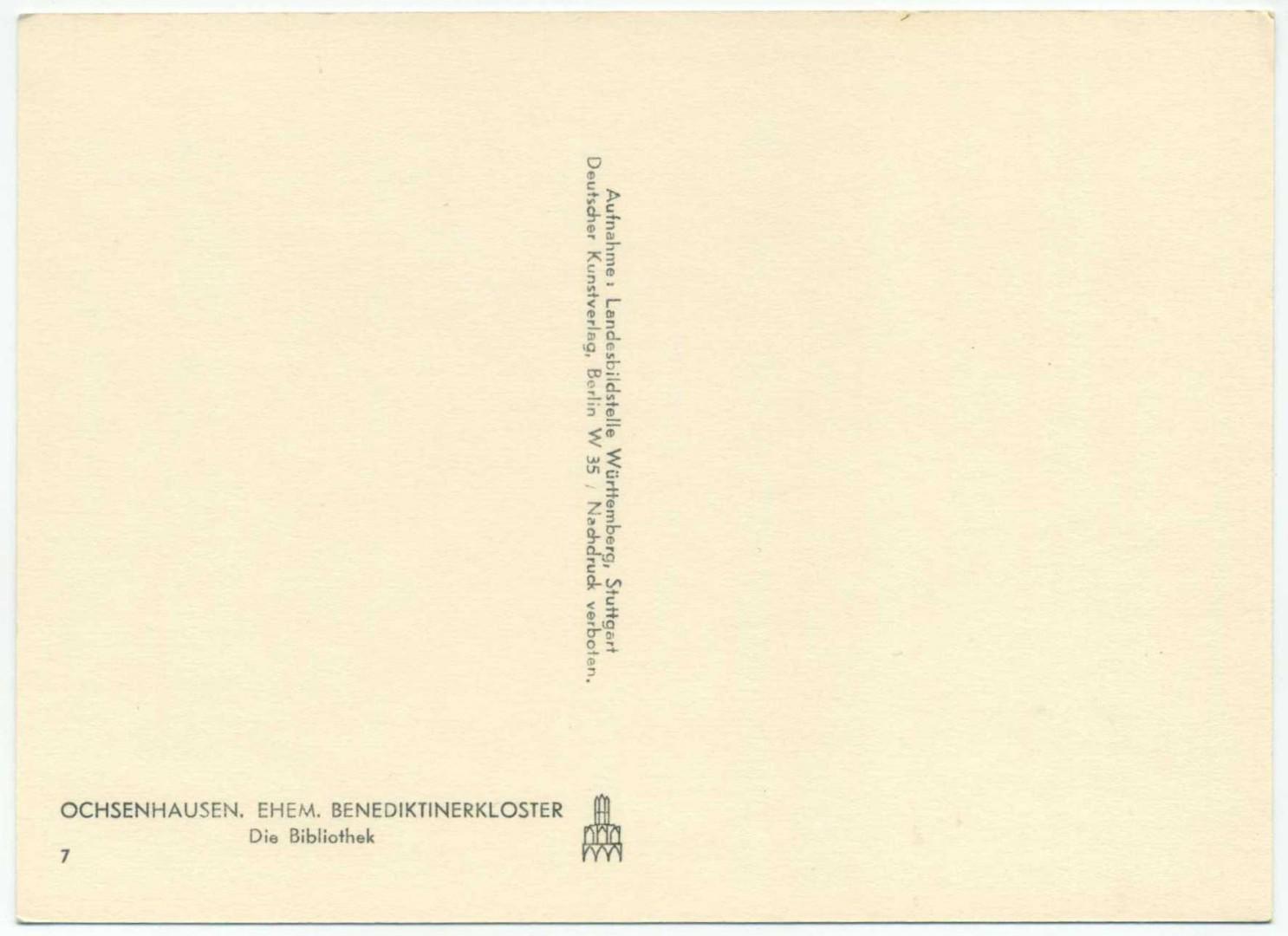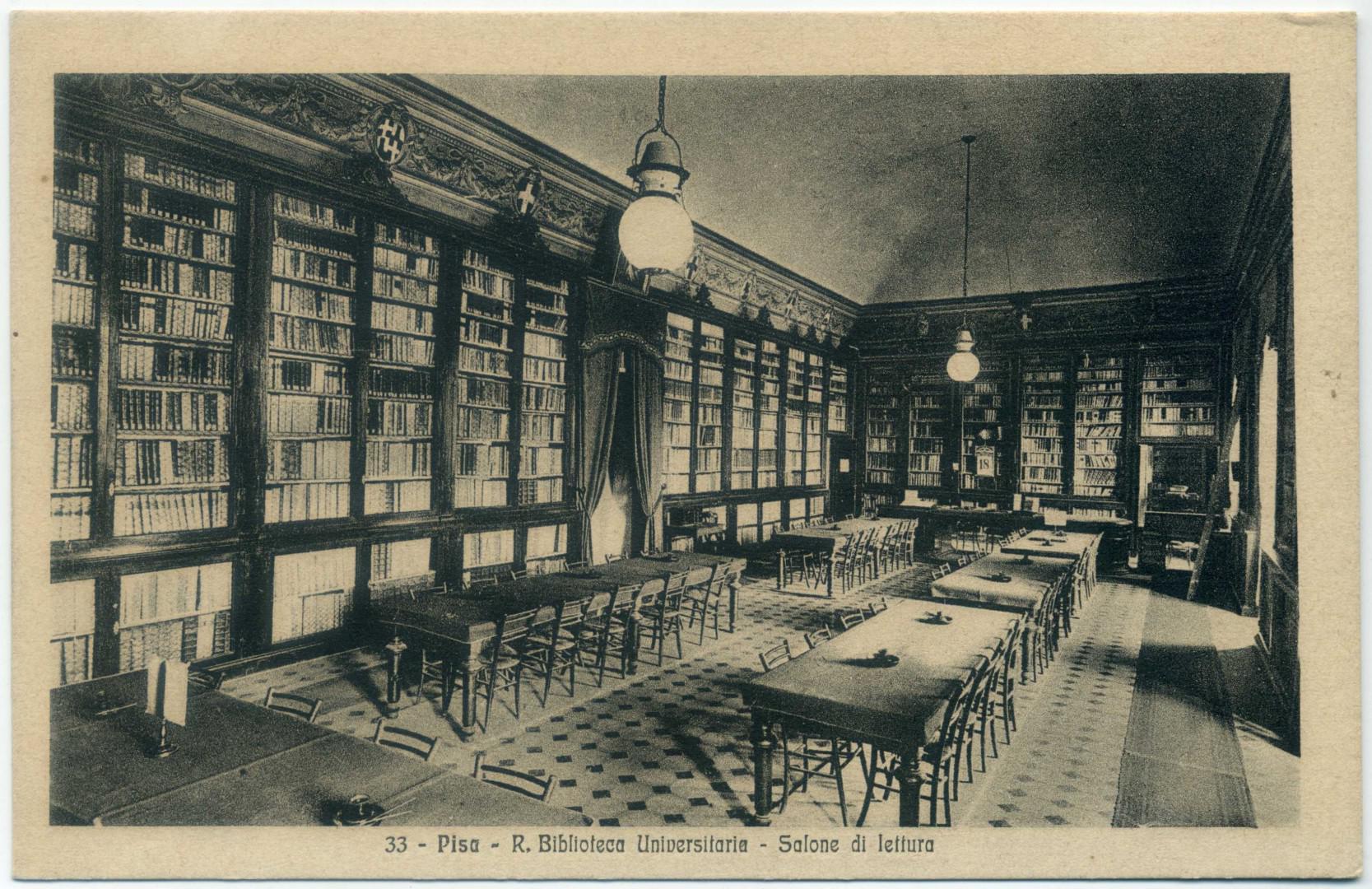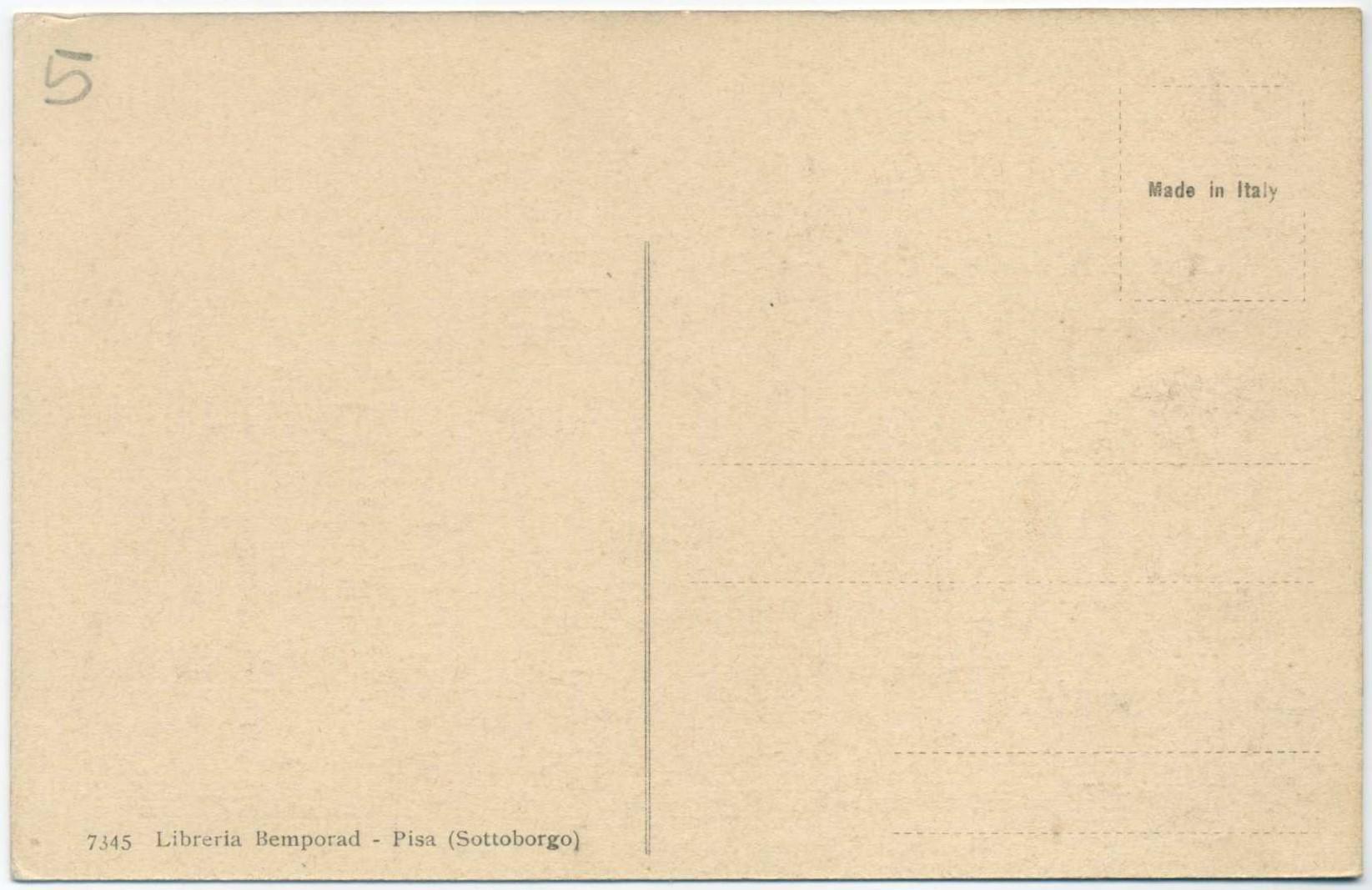|
 |
| Ort: Gent (Gand) Art: Hochschulbibliothek Baustil: Modernismus Architekt: Henry van de Velde (1863-1957) Fertiggestellt/Eröffnet: 1942 Herausgeber: John Prévot, Antwerpen Datierung (Karte): ca. 1940er Jahre |
Zu den berühmten „Drei Türmen“, die seit dem Mittelalter die Stadtsilhouette von Gent zieren – dem Belfried, dem Turm der St.-Bavo-Kathedrale und dem Turm der Sint-Niklaaskerk – kam in den 1930er Jahren ein vierter als „Leuchtturm der Wissenschaft“ hinzu: der Bücherturm (Boekentoren) der Universitätsbibliothek, gelegen auf dem Blandijnberg, dem höchsten Punkt der Stadt. Der flämisch-belgische Architekt und Designer Henry van de Velde, der von 1926 bis 1936 Architektur und Angewandte Kunst an der Universität Gent lehrte, hatte 1933 den Auftrag dafür erhalten. Die Pläne waren 1935 fertiggestellt, in den Jahren 1936-1939 entstand der Rohbau und ein Teil der Ausbauarbeiten. Die Eröffnung erfolgte 1942, die letzten Bauarbeiten zogen sich jedoch noch bis in die 1950er Jahre hin. Van de Velde schuf einen monumentalen Betonbau von 64 m Höhe, der ein wenig an den Aussichtsturm von Albin Müller in Magdeburg aus dem Jahr 1927 (Albinmüller-Turm) erinnert. Der Boekentoren weist einen Grundriss in Form eines griechischen Kreuzes auf und wird oben von einem Belvedere mit vier Terrassen gekrönt. Van de Velde entwarf auch die Innenausstattung und das Mobiliar, das jedoch wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs nur teilweise realisiert wurde. Die Universitätsbibliothek Gent enthält heute an die 3 Millionen Bände. Der Bücherturm wurde in den Jahren 2012 bis 2021 von einem Team um die Architekten Robbrecht & Daem restauriert.